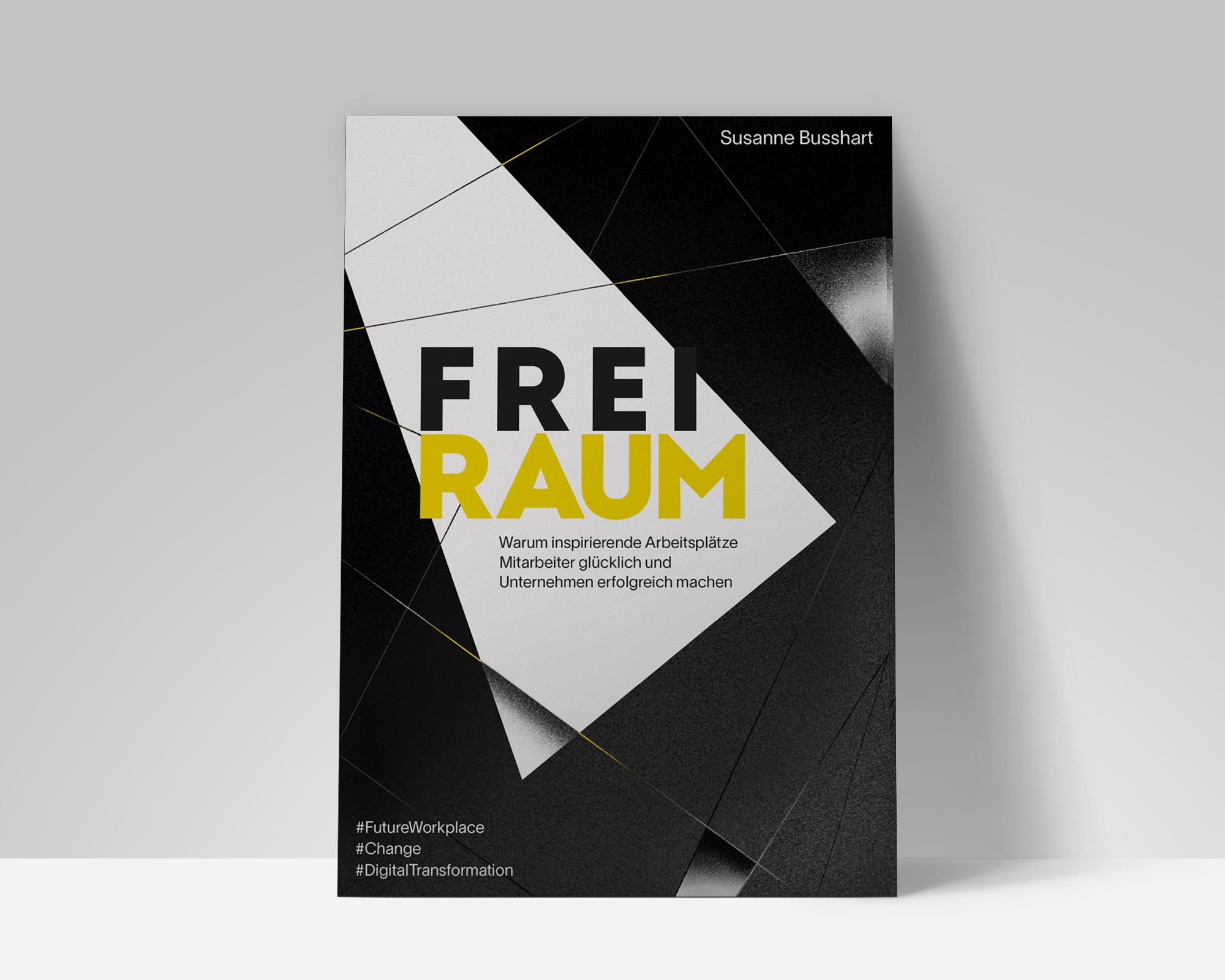Räume, die Menschen verstehen
Unsere Arbeitsumgebung beeinflusst, wie wir denken, fühlen und arbeiten. Doch wer gestaltet eigentlich Räume für jene, deren Wahrnehmung anders funktioniert – für neurodiverse Menschen?
Neurodiversität bedeutet, dass Menschen Reize unterschiedlich stark wahrnehmen. Geräusche, Licht, Farben oder Gerüche können inspirierend, aber auch überfordernd wirken.
Wenn wir also über inklusive Arbeit sprechen, müssen wir auch über inklusive Räume sprechen – über Orte, die Sicherheit, Fokus und Wohlbefinden ermöglichen.
Vom Multi-Space zum Neuro-Space
Das Konzept des Multi-Space-Office hat schon vor Jahren erkannt, dass Arbeit unterschiedliche Zonen braucht – für Konzentration, Austausch, Kreativität oder Rückzug.
Der nächste logische Schritt ist, diese Vielfalt auch neurologisch zu denken.
•Autistische Menschen fühlen sich in ruhigen, strukturierten Zonen wohler – Silent Rooms oder kleine, klar abgegrenzte Arbeitsbereiche schaffen hier Entlastung.
•ADHS-Betroffene hingegen profitieren oft von anregenden, offenen Umgebungen mit Bewegung, Austausch und Flexibilität.
Es geht nicht darum, neue Schubladen zu schaffen, sondern Varianz zuzulassen. Jeder Mensch braucht etwas anderes, und gute Raumkonzepte erkennen das an.
Gestaltung mit allen Sinnen
Neurodiversität ist multisensorisch. Deshalb müssen auch Räume mit allen Sinnen gestaltet werden.
1. Akustik:
Geräusche sind einer der größten Stressfaktoren. Schallabsorbierende Materialien, akustische Zonen und Noise-Cancelling-Kopfhörer können helfen, Reizüberflutung zu vermeiden.
2. Licht & Farbe:
Natürliches Licht, sanfte Farben wie Blau oder Grün und der Einsatz von Holz oder Kork schaffen Ruhe. Blinkende Monitore oder grelle Neonlichter dagegen können überfordern.
3. Haptik:
Materialien mit angenehmer Struktur wirken beruhigend. Kleine Details – etwa ein Fidget-Spinner-Korb statt des klassischen Obstkorbs – können große Wirkung haben.
4. Digitale Räume:
Auch digitale Tools sollten neurodivers gedacht sein: strukturierte Interfaces, klare Kommunikation, Apps zur Konzentrationsförderung oder Pausenerinnerung.
Innere und äußere Räume
Räume sind nicht nur physische Orte. Sie spiegeln auch Haltungen wider.
Ein „neurofreundliches Büro“ entsteht nicht nur durch Möbel, sondern durch ein Mindset der Offenheit.
Wenn Führungskräfte erkennen, dass Ruhe, Rückzug oder Bewegung keine Schwäche, sondern Arbeitsstrategien sind, entsteht Vertrauen – und damit Leistungsfähigkeit.
Der Mehrwert für Unternehmen
Inklusive Räume schaffen nicht nur Wohlbefinden, sondern messbare Vorteile:
•höhere Konzentration und Produktivität,
•weniger Stress und Krankheitstage,
•stärkere Mitarbeiterbindung und Kreativität.
Wer Raumgestaltung ernst nimmt, gestaltet Zukunft – und sendet ein klares Signal: Hier darf jeder so arbeiten, wie es seinem Gehirn entspricht.
Fazit: Räume sind mehr als Quadratmeter
Ein wirklich inklusives Büro denkt in Dimensionen, nicht in Flächen. Es bietet Zonen für Ruhe und Dynamik, Struktur und Flexibilität – laut und leise zugleich.
„Laut nach leise“ könnte zum Leitsatz der nächsten Generation von Arbeitsräumen werden – Räume, die Menschen in ihrer Vielfalt wahrnehmen und unterstützen.
Denn wer Vielfalt baut, schafft nicht nur Raum für Arbeit – sondern Raum für Menschlichkeit.
Hier ein Vortrag zum Thema
https://www.builtworld.com/event/future-of-work-diversitaet-gestalten–neurodivers-denken
Future Workspace Trends